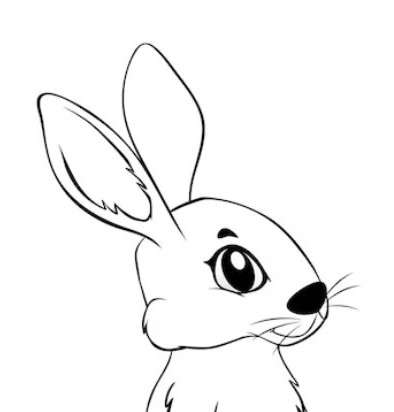Namibia kann mit geringsten Wassermengen haushälterisch umgehen. Samen verweilen Jahrzehnte lang im sandigen Boden, bevor der knochentrockene Grund nach einem Regen förmlich zu neuem Leben explodiert.
Das südwestafrikanische Land Namibia ist rund zwanzig Mal so gross wie die Schweiz, hat jedoch lediglich 2,5 Millionen Einwohner. Grosse Landstriche bestehen aus Wüsten und Halbwüsten, so die 1‘500 km langgezogene Namib entlang der Atlantikküste und die savannenartige Kalahari, welche
sich bis nach Botswana und Südafrika ausdehnt. Es ist deshalb kaum erstaunlich, dass wir uns mit grossen Wasserflaschen ausrüsten, bevor meine Frau und ich die Hauptstadt Windhoek für eine vierwöchige Rundreise verlassen. Wir haben bereits zuhause von der ungewohnten Trockenperiode im südlichen Afrika vernommen.
Wucht des ersten Regens
Doch der afrikanische Wettergott hält sich an keine „Burenregeln“. Fast drei Jahre lang haben Menschen und Tiere vergeblich auf das Nass des Himmels gewartet. Viel Wild verendete, Farmer mussten Vieh notschlachten, Flüsse versiegten komplett. Und so kam die Wucht des ersehnten Regens völlig überraschend und undosiert. In wenigen Stunden fielen unlängst 60 mm Niederschläge, was der lokal durchschnittlichen Menge dreier Jahre entspricht. Das Wasser unterspülte Strassen und Wege, im lockeren Sandboden versickerte es jedoch rasch. Und dort warteten die Sämereien auf ihre Stunde. In den Dünen und trockenen Savannen der Tirasberge treffen wir die eben noch graue Landschaft in zartem Grün. Bunte Blumen schiessen förmlich der Sonne entgegen. Walt Disney mit seinem Filmklassiker „Die Wüste lebt“ hätte sich kaum besser in Erinnerung rufen können.
Die Wassertricks der Natur
Die Natur kennt Tricks und Mechanismen um trotz arider Bedingungen ein vielfältiges Leben zu ermöglichen. Dornenbewehrte Akazien bohren ihre Wurzeln über 40 Meter tief dem Grundwasser entgegen. Ihre saftig grünen Blätter sind als Wasserquelle Spezialisten vorbehalten, welche die Dornenwaffen knacken können, so der Giraffe. Diese hat eine harte Haut im Mund und eine 30 cm lange Zunge, mit welcher sie trotzdem an die Blätter herankommt. Die schwarzen Skelette von abgestorbenen Akazien gelten als heilig. Solche harten Hölzer stehen als Zeugen früherer Jahrhunderte in der sandigen oder gar salzigen Landschaft, denn viele Gewässer Namibias haben keinen Abfluss zum Meer. Sie sammeln sich in Senken, so genannten Vleis, wo deren Wasser verdunstet und lediglich eine Salzkruste zurückbleibt. Die Flüsse im Landesinnern führen oft nur
periodisch Wasser, so auch der Fish River, der den südlichen Landesteil über den Oranjefluss entwässert. Sein während der sogenannten Pluvialzeiten (Regenzeiten) vor vielen Millionen Jahren tief in die Erde gegrabenes Canyon ist mit einer Länge von 161 km nach dem Grand Canyon in Arizona das zweitgrösste Canyon der Erde und zeugt von damals völlig anderen klimatischen
Bedingungen. Der Spiessbock (Oryx gazella) trinkt überhaupt nicht, sondern frisst Wurzeln oder wilde Melonen mit Saft. Sein Fleisch ist fast fettlos. Ähnliches gilt für den Springbock (Antidorcas marsupialis). Die Nara Melonen (Acanthosicyos horridus) gehören zu den Kürbisgewächsen und benötigen viel Wasser. Sie haben bis zu 30 m lange Pfahlwurzeln. Da sie keine Blätter haben, ist auch deren Verdunstung auf ein Minimum reduziert.
Eine urtümliche Pflanze kann Jahrtausende alt werden
Eine ausserordentliche Anpassung an besondere Wasserverhältnisse weist die Pflanze Welwitschia mirabilis auf, welche zu den Zapfen tragenden Nacktsamern gehört und uralt werden kann. Ein über 1‘500 Jahre altes Exemplar kann mit kundiger Führung nahe von Swakopmund in der Wüste besucht werden. Die beiden gegenständigen harten Blätter werden vom Wind jeweils in Streifen gespalten. Welwitschien nutzen den Morgennebel zur Feuchtigkeitsaufnahme. Jeder Zapfen trägt etwa 100 Samen, die vom Wind vertragen werden. Die meisten werden von kleinen Wüstentieren gefressen oder von Pilzinfektionen betroffen. Die wenigen Samen, welche übrig bleiben keimen nur, wenn relativ starke Regenschauer ein paar Tage lang anhalten. Da diese idealen Zustände in der Wüste selten vorkommen, haben die Pflanzen einer Kolonie meist alle das gleiche Alter.
Da auch die Menschen mit der Trockenheit leben müssen, geben sich die Buschleute vom Stamm der San ihre Erfahrungen von Generation zu Generation weiter. So nutzen sie die grossen Strausseneier als Wassergefässe und entdecken die wasserführenden Bodenschichten mit Kenneraugen. Stefan aus Südafrika erzählt, dass manche Böden östlich von Windhoek in der Kalahari dermassen feucht seien, dass man mit dem Schuh nach Wasser graben könne. Sande können Wasser relativ rasch aufnehmen und wirken auch als dessen Speicher. Sedimente wie Kalksteine lassen ebenfalls Grundwasservorkommen zu. Mehrere Wasserstellen entstehen dadurch, dass das in der Regenzeit in der porösen Kalkformation angesammelte Wasser auf dem undurchlässigen Tonboden ausfliesst. Weitere Arten von Quellen sind Artesische Brunnen, welche das Wasser aus grösseren Distanzen anliefern. Das Wasser aus dem Gebirge oder von Regenfällen sammelt sich oft in den Senken, welche keinen Abfluss haben. Wasserflächen werden uns da und dort als Fata Morgana vorgegaukelt. Beim Austrocknen der Seen entstehen riesige Salzkrusten. Die grösste in Namibia ist die Etoshapfanne. Sie bedeckt ein Gebiet von 5‘000 km2 und erstreckt sich vom Osten nach Westen über 129 km.
Grosse Staudämme sichern die Wasserversorgung
Grosse Staudämme wie der Naute-Damm, der Hardap-Damm oder der Neckartal-Damm sorgen heute für die Wasserversorgung der Zentren und der Landwirtschaft. Die Eröffnung des grössten Stausee des Landes ist mit italienischer Hilfe im Oktober 2018 geplant. Deutsche Hydrogeologen sind
2012 im Cuvelai-Etosha-Becken im trockenen Norden Namibias auf ein riesiges Grundwasserreservoir von rund fünf Milliarden Kubikmeter Wasser gestossen, welches dem Land Trinkwasser für die nächsten vier Jahrhunderte sichern könnte. Das über 10‘000 Jahre alte Wasser ist in einer Tiefe von mehr als 200 Metern entdeckt worden. Es liegt unter einer 100 Meter mächtigen Sperrschicht. Um
dieses Reservoir zu erreichen, müssen die Bohrungen allerdings sehr vorsichtig angegangen werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Süsswasser durch Salzwassereinschlüsse kontaminiert oder durch Menschen verschmutzt wird. Zudem steht das Wasser in dem fast hermetisch abgeschlossenen Tiefenreservoir unter erheblichem Druck. Daher müssen die nötigen Pumpen nur in eine Tiefe etwa 30 Meter gebracht werden. Die übrige Distanz steigt das Wasser allein schon wegen des erheblichen Tiefendrucks.
Nomadenvolk wehrt sich gegen Stausee
Das nördliche Nomadenvolk der Himba hofft, dass nun auch der umstrittene Bau eines Staudamms bei den Epupa-Wasserfällen an der Grenze zu Angola ad acta gelegt wird. Der Damm würde die Weidegebiete des Volkes unter Wasser setzen sowie ihre Ahnengräber fluten und zerstören. Diese spielen in der Religion und bei rituellen Handlungen des einzigartigen Stammes eine zentrale Rolle, weshalb sich die Menschen seit Jahrzehnten gegen den Bau eines Stausees wehren. Andernfalls könnte den Himba vielleicht auch eine Delegation aus der Talschaft Ursern beratend beistehen.

Wanderdünen in den Tirasbergen

Bunte Blumen (Tribulus terrestris) im namibischen Sandboden

Das Fish River Canyon entstand in einer prähistorischen Regenzeit

Buschmann Johannes erklärt die Natur und die Lebensweise der San

Tote und lebendige Akazie. Sie gelten als heilig und haben über 40 m tiefe Wurzeln

An den Wasserstellen im Etosha Nationalpark sammeln sich die Wildtiere
(erschienen im Urner Wochenblatt Nr. 62 vom Mittwoch 8. August 2018)